Die Welt physikalisch gesehen
Ausgezeichnete Artikel
H. Joachim Schlichting. Spektrum der Wissenschaft Spezial 1.22 (2022) 82 Seiten
Physikalischer Reiz des Gewöhnlichen
Die Menschen haben von jeher die Natur nicht nur wahrgenommen, sondern die Natur auch auf die eine oder andere Weise zu verstehen versucht. Aus heutiger Perspektive erstaunlich tief gehende physikalische Einsichten hat bereits Leonardo da Vinci vor mehr als 500 Jahren bei seinen zahlreichen Beobachtungen und zeichnerischen Rekonstruktionen bewiesen. Damals war die neuzeitliche Physik noch im Entstehen begriffen, sodass man nur darüber staunen kann, wie klar und verständlich Leonardo viele Alltagsbeobachtungen dargestellt hat. Die Kunst kam ihm bei der grafischen Rekonstruktion der Phänomene sehr zugute (S. 6).
Physik und Kunst haben sich von jeher gegenseitig befruchtet und zahlreiche Erscheinungen inspirieren oft durch ihren ästhetischen Reiz dazu, sie näher zu erschließen.
Aber selbst profan wirkende Vorgänge führen manchmal erstaunlich weit bis in die moderne Forschung.
So ist es eine alltägliche Erfahrung, Schnecken auf ihrem glitschigen Schleimfilm gleiten zu sehen. Denkt man jedoch an die eigenen Fortbewegungsprobleme (S. 40), drängen sich Fragen geradezu auf. Wie stellt es die Schnecke an, bergauf zu gleiten oder sich überhaupt vom glitschigen Schleim abzustoßen? (S. 64).
Die wissenschaftliche Antwort führt direkt in die Küche, in der wir es mit ähnlichen Problemen zu tun haben, wenn beispielsweise der Ketchup aus der Flasche wohldosiert auf dem Teller landen soll (S. 72). Flüssigkeiten können je nach mechanischer Einwirkung zwischen zäh- und leichtflüssig wechseln. In Form von Schaum ähneln manche Gemische sogar einem Festkörper (S. 70). Selbst reines Wasser zeigt oft faszinierende Strukturen und überraschende Schauspiele. Es ist sogar musikalisch: Spült man nach der Teepause sein Edelstahlsieb, so bekommt man zuweilen schöne Töne zu hören. Dahinter steckt ein komplexer Vorgang, der erst zum Mysterium wurde, seitdem es diese Teesiebe gibt (S. 78). Andere Strömungsereignisse sind altbekannt, aber nicht weniger imposant und fordern geradezu dazu heraus, selbst ausprobiert zu werden.
Lassen Sie sich durch diese Sammlung inspirieren, fortan den Alltag mit neuen Augen zu sehen.
Ihr H. Joachim Schlichting.
 Schlichting, H. Joachim. Spektrum der Wissenschaft Spezial 1.19 (2019), 82 Seiten
Schlichting, H. Joachim. Spektrum der Wissenschaft Spezial 1.19 (2019), 82 Seiten
Vertrautes aus physikalischer Sicht
Es schien, als seien die umkränzten Lichtkreuze über Nacht in die Welt gesetzt worden. Nachdem ich diese merkwürdigen Objekte an Häuserwänden und Straßen (siehe S. 30) zum ersten Mal entdeckt hatte, sah ich sie von diesem Tag an überall. Freilich müssen die seltsamen Figuren schon vorher immer wieder auf meine Netzhäute gelangt sein, doch ich hatte sie bis dahin nicht bewusst wahrgenommen. Das ist typisch für viele Phänomene im Alltag und in der Natur. Man muss regelrecht lernen, sie zu sehen – und das gelingt am besten, indem man durch möglichst viele Beispiele dazu angeregt wird. Weiterlesen
Schlichting, H. Joachim. Spektrum der Wissenschaft Spezial 3 (2016), 82 Seiten
Der Alltag wartet mit einigen Überraschungen auf, wenn man bereit ist, seine Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Oft sind es gerade die unscheinbaren Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, die unversehens zu einer neuen Wirklichkeit werden. Wie schafft es beispielsweise das Wasser bis in die Baumspitzen? Warum springt Popcorn wild in der Pfanne herum?
Was verursacht die schillernden Farben, die wir manchmal beim Blick auf helle Lichtquellen sehen? Die hier versammelten Phänomene sind so verschieden und facettenreich wie der Alltag in der technischen und natürlichen Welt. Das Geheimnisvolle offenbart sich nicht selten im Trivialen, und das Erhabene liegt oft dicht neben dem Banalen. Der Physikdidaktiker H. Joachim Schlichting enthüllt, was sich hinter alltäglichen Phänomenen verbirgt. Die hier versammelten Beiträge stammen aus der Rubrik „Schlichting!“ in der Reihe „Spektrum der Wissenschaft“.
Weitere Informationen findet man hier.
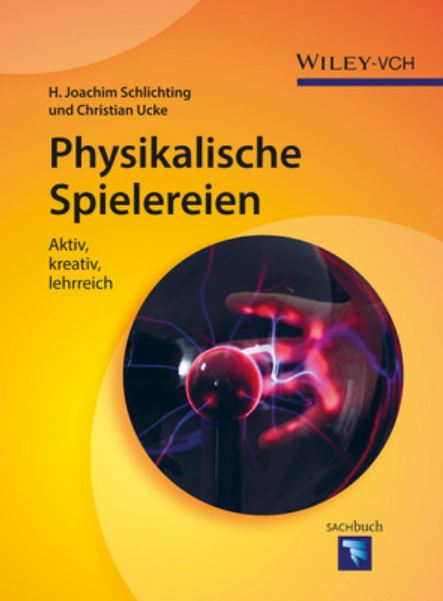 Schlichting, H. Joachim; Ucke, Christian. In: Weinheim: Wiley-VCH 2016, ISBN-978-3-527-41108-5
Schlichting, H. Joachim; Ucke, Christian. In: Weinheim: Wiley-VCH 2016, ISBN-978-3-527-41108-5
ISBN-13: 978-3527409501
Produktbeschreibung
Joachim Schlichting und Christian Ucke zeigen in diesem reich illustrierten Buch: die Physik hat eine spielerische Seite, die man genießen und von der man gleichzeitig viel lernen kann. In einzelnen Kapiteln zu vier großen Themenbereichen der Physik – Mechanik, Thermodynamik, Elektromagnetismus, Optik – stellen sie ungewöhnliche, überraschende, unterhaltsame physikalische Spielereien und Phänomene vor, von Ketten, die sich von selbst zur Fontäne aufbäumen über merkwürdig anschwellende Töne beim Kaffeetrinken bis zu schwebenden Kreiseln und handgemachten Hologrammen. Manche der beobachteten Effekte beruhen auf recht einfachen physikalischen Prinzipien, bei anderen wiederum muss man weiter in die Tiefe gehen, um sie verstehen zu können. Doch alle physikalischen Spielereien haben eins gemeinsam: es macht einfach Spaß, sich mit ihnen zu beschäftigen, und der Aha-Effekt kommt nie zu kurz! Weiterlesen
 Schlichting, H. Joachim. Spektrum der Wissenschaft Spezial 3 (2014), 82 Seiten
Schlichting, H. Joachim. Spektrum der Wissenschaft Spezial 3 (2014), 82 Seiten
Ob die Geschehnisse in einer Kaffeetasse, die Tropfen am beschlagenen Fenster oder die Mondphasen: Die vielfältigen Phänomene des Alltags erscheinen uns so vertraut, dass wir den darin wirkenden Gesetzen der Physik keine Beachtung schenken. Wer sie aber doch verstehen will, wie es der Physikdidaktiker H. Joachim Schlichting in diesem Sonderheft tut, gewinnt einen völlig neuen und überraschenden Blick auf die Realität.
(28. August 2014) Weitere Informationen finden Sie hier. Weiterlesen
Schlichting, H. Joachim. Darmstadt: Primus Verlag 2012
„Hans Joachim Schlichting ist etwas selten Schönes gelungen.  Alltagsgegebenheiten aus dem Dickicht des gewohnt alltäglichen Blicks herauszuholen, eindrucksvoll aufs Bild zu bannen und dann auch noch mit physikalischen Augen zu sehen oder gar erst zu erkennen ist schon schwierig genug. Solche Phänomene dann auch noch mit einfachen Worten zu beschreiben und zu erklären gelingt derart selten, dass dieses Buch sich deutlich aus der populärwissenschaftlichen Literatur über Phänomene in Physik und Natur heraushebt. Hier trafen das außergewöhnliche Talent eines passionierten Amateurfotografen mit dem in vielen Jahren angesammelten Wissen eines Fachmanns der Physikdidaktik zusammen. Weiterlesen
Alltagsgegebenheiten aus dem Dickicht des gewohnt alltäglichen Blicks herauszuholen, eindrucksvoll aufs Bild zu bannen und dann auch noch mit physikalischen Augen zu sehen oder gar erst zu erkennen ist schon schwierig genug. Solche Phänomene dann auch noch mit einfachen Worten zu beschreiben und zu erklären gelingt derart selten, dass dieses Buch sich deutlich aus der populärwissenschaftlichen Literatur über Phänomene in Physik und Natur heraushebt. Hier trafen das außergewöhnliche Talent eines passionierten Amateurfotografen mit dem in vielen Jahren angesammelten Wissen eines Fachmanns der Physikdidaktik zusammen. Weiterlesen
Ucke, Christian; Schlichting, H. Joachim. In: Weinheim: Wiley-VCH 2011, ISBN-10: 3527409505
ISBN-13: 978-3527409501
Produktbeschreibung: Auf den ersten Blick überrascht die inhaltliche, methodische und phänomenologische Verschiedenheit der Themen in diesem anregenden Mitmach-Buch, denn die Auswahl reicht von Spielzeugen im klassischen Verständnis über Designobjekte bis zu interessanten Gegenständen und Phänomenen des Alltags. Aber auch die Zugänge zu den Themen sind unterschiedlich! Mal stehen exploratorische und experimentelle Aspekte im Vordergrund, mal theoretische Grundlagen. Immer geht es aber um die Freude am Spiel, denn „Spiel, Physik und Spaß“ will zum Nachdenken und Mitmachen anregen. Für jedes Alter findet sich etwas: Einiges spricht schon Kinder im Vorschulalter an, anderes ist für Schüler, Studenten oder Lehrer von Interesse, wieder anderes werden ältere Leser als Spielzeug aus ihrer Jugendzeit erkennen. Weiterlesen



